Warum hältst Du an einer Person fest, die Dir eigentlich nicht guttut? | Teil 1
by Witchcraft | Aug. 11, 2025 | Achtsamkeit, Liebe, Seelenpartner | 0 comments

Psychologische Ursachen und Hintergründe aus der Sicht von Liebe, Beziehung und Liebeskummer
Es ist eines der größten menschlichen Paradoxe: Du spürst tief in Dir, dass Dir eine Beziehung nicht gut tut, dass sie Dich verletzt, Dich emotional auslaugt oder Dir sogar körperlich schadet – und trotzdem kannst Du diese Person nicht loslassen. Dieses Festhalten ist keine Schwäche, sondern Ausdruck komplexer psychologischer und neurobiologischer Mechanismen, die tief in Deinem System verankert sind. Verstehst Du diese Zusammenhänge, kannst Du besser nachvollziehen, warum Loslassen so schwerfällt und wie Du Schritt für Schritt wieder zu Dir selbst findest.
1. Deine frühen Bindungserfahrungen prägen Dein Beziehungsverhalten
Schon als Kind hast Du unbewusst gelernt, wie Beziehungen funktionieren: ob Du Dich sicher, geliebt und geschützt fühlst – oder ob Du eher Angst vor Nähe hast. John Bowlby und Mary Ainsworth zeigten, dass diese frühen Erfahrungen Deinen Bindungsstil formen.
Wenn Du einen ängstlich-ambivalenten Bindungsstil hast, bist Du besonders anfällig für das Festhalten an problematischen Beziehungen. Deine Bindungshormone und Dein Bindungssystem werden aktiv, sobald Du das Gefühl hast, den Menschen zu verlieren, den Du liebst. Paradoxerweise steigert diese Angst vor Verlust oft die emotionale Anziehungskraft – selbst wenn die Beziehung schädlich ist. Das Bindungssystem funktioniert also wie eine Art Schutzmechanismus, der Dich emotional an die Person fesselt, um Trennung zu vermeiden.
Quelle: Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
2. Du bist gefangen im „Beziehungs-Glücksspiel“ der intermittierenden Verstärkung
Vielleicht hast Du es selbst schon erlebt: Es gibt diese Momente, in denen Dein Partner Dir Zuneigung schenkt – vielleicht liebevolle Worte, Aufmerksamkeit oder Nähe –, aber diese Momente sind unregelmäßig, selten und nicht vorhersehbar. Das ist keine Zufälligkeit, sondern ein mächtiger psychologischer Mechanismus namens intermittierende Verstärkung.
Dieses Prinzip wurde von B.F. Skinner erforscht und beschreibt, wie Belohnungen, die unregelmäßig verteilt werden, stärker anziehend sind als regelmäßige. Dein Gehirn reagiert auf die Unsicherheit mit erhöhter Dopaminausschüttung – dem „Glückshormon“, das Dich süchtig macht nach diesen wenigen, intensiven Momenten. So fühlst Du Dich trotz Schmerzen immer wieder zu der Person hingezogen, als würdest Du auf einen emotionalen Jackpot hoffen.
Quelle: Ferster, C. B., & Skinner, B. F. (1957). Schedules of Reinforcement. Appleton-Century-Crofts.
3. Dein Gehirn verknüpft Schmerz und Belohnung eng miteinander
Wenn Du intensive Gefühle erlebst – sowohl schöne als auch schmerzhafte –, aktiviert Dein Belohnungssystem Regionen wie das ventrale Striatum und den Nucleus accumbens. Gleichzeitig wird Oxytocin, das Bindungshormon, ausgeschüttet. Dieses Hormon sorgt dafür, dass Du Dich emotional an die andere Person bindest, auch wenn die Beziehung toxisch ist.
Das bedeutet: Dein Körper und Dein Gehirn programmieren Dich auf Nähe, auch wenn diese Nähe Dir nicht guttut. Wiederholte emotionale Erlebnisse verankern die Beziehung tief in Deinem neuronalen Netzwerk, sodass Dein Verlangen nach der Person automatisch wird – und das Loslassen biologisch sehr schwerfällt.
Quelle: Insel, T. R., & Young, L. J. (2001). The neurobiology of attachment. Nature Reviews Neuroscience, 2(2), 129–136.
4. Du versuchst, Deinen inneren Konflikt mit kognitiver Dissonanz zu lösen
Wenn Du viel Zeit, Liebe und Energie in eine Beziehung investiert hast, fällt es Dir schwer, Dir einzugestehen, dass sie Dir schadet. Dieses unangenehme Gefühl nennt man kognitive Dissonanz.
Um diesen inneren Konflikt zu reduzieren, suchst Du unbewusst nach Argumenten, warum es sinnvoll ist zu bleiben – Du blendest negative Seiten aus und idealisierst das, was Du Dir erhoffst. Diese Selbstrechtfertigung schützt Dein Selbstbild und bewahrt Dich davor, Dein bisheriges Engagement als „Fehler“ wahrzunehmen.
Quelle: Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
5. Deine Identität und Dein Selbstwert sind eng mit der Beziehung verbunden
Vielleicht hast Du das Gefühl, dass Du ohne diese Person weniger wert bist oder nicht vollständig. Dein Selbstwertgefühl hängt oft daran, wie sehr Du von Deinem Partner bestätigt wirst.
Wenn Dein Selbstwert labil ist, kann es sein, dass Du sogar den Schmerz in der Beziehung als Beweis für Liebe oder Bedeutung wertest. Das macht es noch schwerer, Dich zu lösen, weil Du Angst hast, Deine Identität oder Deinen Halt zu verlieren.
Quelle: Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: How perceived regard regulates attachment processes. Journal of Personality and Social Psychology, 78(3), 478–498.
6. Du hältst an der Hoffnung auf Veränderung fest
Ein weiterer Grund, warum Du nicht loslassen kannst: Du glaubst daran, dass die andere Person sich ändern kann oder „im Kern“ gut ist. Diese Hoffnung ist ein kraftvoller psychologischer Verstärker, besonders wenn Du empathisch bist oder eine Retter-Mentalität hast.
Du möchtest den Schmerz überwinden und glaubst, dass Liebe alles verändern kann. Doch oft ist diese „Change Fantasy“ eine Illusion, die Dich in der Beziehung hält – auch wenn objektive Anzeichen dagegen sprechen.
Quelle: Davis, K. E., Ace, A., & Andra, M. (2000). Stalking perpetrators and psychological maltreatment of partners: Anger-jealousy, attachment insecurity, need for control, and break-up context. Violence and Victims, 15(4), 407–425.
Fazit:
Das Festhalten an einer Person, die Dir nicht guttut, ist keine Schwäche, sondern ein Zusammenspiel aus:
-
Deinen frühen Bindungserfahrungen,
-
dem emotionalen Belohnungssystem Deines Gehirns,
-
inneren Schutzmechanismen wie Selbstrechtfertigung,
-
der Verknüpfung von Selbstwert und Beziehung,
-
und der Hoffnung auf Veränderung.
Loslassen ist deshalb kein einfacher Akt des Willens, sondern ein Prozess, der Achtsamkeit, Selbstreflexion und oft auch therapeutische Unterstützung erfordert. Indem Du diese Mechanismen verstehst, kannst Du Deinen eigenen Weg zu emotionaler Freiheit und gesunden Beziehungen finden.
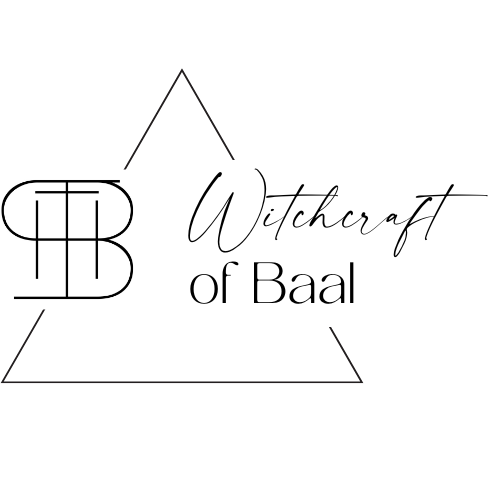
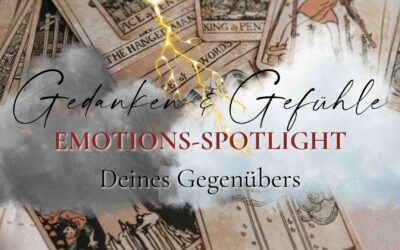
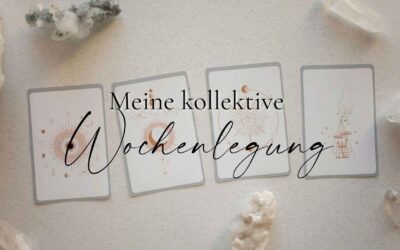
0 Comments